LUMO (PSN)
Der Herbstbeginn hat nicht nur einige schöne Tage mit sich gebracht, sondern auch eine Handvoll Indie-Spiele, die man seit kurzer Zeit nun auch im Handel erwerben kann. Vor kurzem haben wir euch in diesem Zusammenhang schon „Assault Suit Leynos“ und „Super Meat Boy“ vorgestellt, nun möchten wir das mit „LUMO“ fortsetzen.
Geschichte
Die Geschichte von „LUMO“ erinnert ein klein wenig an „Tron“ – ein ganz normaler Junge wird durch einen technischen Defekt über die Webcam in ein Videospiel gezogen. In diesem ist er von nun an ein kleiner Magier in einem Kerkerverlies, der einen Weg zurück in die Realität finden muss, wozu er vier alte Hardware-Komponenten finden muss.
Erkundung der Kerkerräume
„Lumo“ ist ein isometrisches Abenteuer im klassischen Stil. Mit dem kleinen Magier begibt man sich fortan bei der Suche durch mehr als 400 Kerkerräume. Das Spielgeschehen ist dabei zunächst recht simpel aufgebaut: Einen Kerkerraum betritt man dazu durch eine schwere Holztür. Ein kurzer Blick durch den Raum zeigt einem direkt, wo die Tür beziehungsweise Türen zu den nächsten Räumen sind. In der Regel sind diese entweder nur dadurch zu erreichen, dass man eine Geschicklichkeitspassage oder ab und an auch ein kleines Rätsel löst.
Ersteres ist allerdings die Regel, und so hüpft man beispielsweise über sich bewegende Plattformen oder schwingt von Seil zu Seil, während giftige Säure unter einem nur darauf wartet, dass man einen Sprung nicht hundertprozentig erwischt und kurz darauf das Zeitliche segnet. Selbiges passiert übrigens recht häufig, da man die Kamera nicht frei bewegen, sondern nur etwas schwenken kann. Dadurch ist gerade die Position von Wandplatten, Holzbalken und Seilen, die sich im hinteren Teil des Raumes befinden, nicht immer eindeutig erkennbar. Das sorgt für Frust, spätestens wenn die Kerkerräume in Schnee und Eis getaucht werden und damit alles sehr rutschig ist. Natürlich gibt es auch wieder kleinere Rätsel, wie Schieberätsel mit Eisblöcken oder Schalterrätsel mit Wasser, die allerdings in der Regel recht einfach sind. Außerdem kann der kleine Magier im späteren Verlauf auch auf seinen Zauberstab zurückgreifen, beispielsweise um unsichtbare Plattformen zu entdecken oder eklige Spinnen zu vertreiben.
Auf der Jagd nach Sammelobjekten
Zudem gibt es eine Handvoll Auflockerungen, absolutes Highlight dabei ist sicherlich die Fahrt mit der Lore. Allerdings wird man auch beim Hüpfen durch die Warp-Zone oder auf der Flucht vor einer riesigen Steinkugel etwas vom Abenteuer abgelenkt. Eine schöne Sache sind die zu findenden Bonusgegenstände – am auffälligsten dabei sind die 32 gelben Quietscheenten, die sich meist irgendwo abseits des Weges aufhalten und nur durch eine große Portion Sprunggeschick erreicht werden können. Zusätzlich gibt es allerdings auch noch weitere Sammelobjekte wie Kartenteile oder Münzen. – Wer möchte, kann übrigens auch versuchen, „LUMO“ im Old-School-Modus mit begrenzter Lebensanzahl zu spielen. Wir raten auf Basis unserer Erfahrungen aber zumindest davon ab, diesen Spielmodus direkt zu Beginn zu wählen.
Technik
Zunächst bekommt man einen Schreck, wenn man das Abenteuer beginnt. Die reale Welt ist nämlich grafisch ein Schlag in die Magengrube, so einfach ist die Programmierung und so schlecht die Optik. Zum Glück ändert sich das, als wir in die virtuelle Welt gezogen werden. Grundsätzlich sind die Kerkerräume zwar alle ähnlich gestaltet, aber in ihrer Form und „Möblierung“ anders. Zu letzterem zählt natürlich die grundsätzliche Raumausstattung, wie Fässer, Kisten oder Tische, die Art der Hindernisse, etwa giftige Säure, eisige Plattformen oder Wasserbecken, und Fallen und Feinde, wie Flammensäulen, eklige Spinnen oder stachlige Metallkugeln. Der gewählte Grafikstil ist durchaus charmant, vor allem wenn der kleine Magier mit seinem überdimensional großen Hut durch die Räume flitzt oder man eine Liebeskiste dazu gebracht hat, einem zu folgen. Trotzdem fallen einem kleinere Unsauberkeiten in den spielerischen Übergängen auf, die nicht hätten sein müssen. Akustisch hat das Spiel leider keine positiven Aspekte beizutragen – die Melodien bleiben schwach, der Wiederbelebungston nach dem Ableben geht einem irgendwann nur noch auf die Nerven.






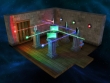


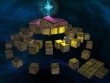

Das sagen unsere Leser: