Last Day of June (PSN)
Massimo Guarini sagt wahrscheinlich zunächst nur den wenigsten etwas. Der italienische Entwickler hat sich mit seinen Projekten „Shadows of the Damned” und dann „Murasaki Baby” einer Zielgruppe für abgefahrene Spiele einen Namen machen können. Jetzt kehrt er mit „Last Day of June” zurück und erzählt eine Geschichte über Verlust, Kummer, Liebe und Hoffnung. Ob es uns emotional mitreißen konnte, zeigt die folgende Review.
Um über „Last Day of June” zu sprechen, müssen wir einige Grundelemente und die Prämisse verraten. Wer also gar nichts zum Spiel wissen möchte, was verständlich ist, da es voll auf die Geschichte setzt, der sollte auch diese Review nicht lesen.

Der rollende Schmetterling
Wie der Name schon verrät geht es um den letzten Tag von June. Denn nach einem sehr romantischen Tag am See fahren June und Carl mit ihrem Auto während eines Sturms wieder zurück und werden in einen Unfall verwickelt. Ab dem Punkt wacht Carl immer wieder auf und findet sich gelähmt wieder, während seine Frau gestorben ist. Aber in einer Art Zwischenwelt kann er durch die Gemälde der Mitbewohner des Dorfes den letzten Tag noch einmal neu erleben und die Ereignisse so ändern, dass sie vielleicht in keinem tragischen Unfall enden.
„Last Day of June” hat als besonderes Element eben diese Mischung aus „Täglich grüßt das Murmeltier” und „Butterfly Effect”. Es geht nicht darum eine große Geschichte zu erzählen, sondern viel mehr um die Aussichtslosigkeit beim Retten seiner Frau, indem er die Ereignisse immer wieder verändert aber am Ende wieder hoffnungslos im Rollstuhl sitzt. Es ist ein interessantes Konzept, das man in Videospielen so nur selten sieht, aber aus Filmen kennt. Da das Ganze aber wirklich auf einer sehr geerdeten und vor allem auch familiären Ebene bleibt, fühlt es sich frisch an. Es muss nicht immer der große Weltenretter sein, es reicht auch mal einen Mann zu spielen, der alles daran setzt, um seine Frau zu retten.
Fehlende Augen
Ein weiteres Highlight sind auch die Figuren, die durch die fehlenden Augen erst befremdlich wirken. Die Macherin der Animationen ist Jessica Cope, die bereits an „Frankenweenie” oder auch einem Musikvideo zu „Drive Home” von Steven Wilson gearbeitet hat, das Inspiration für das gesamte Spiel war. Aber wenn man sich einmal drauf eingelassen hat, dann merkt man, dass dahinter so viel mehr steckt. Jeder dieser Charaktere, die allesamt nur Fantasie-Laute von sich geben, haben eine meist traurige Hintergrundgeschichte und geben ihnen ein wenig Charakter für das, was sie tun. Um sich komplett von ihren Geschichten überzeugen zu lassen, muss man aber auch die gesamten sammelbaren Gegenstände finden.

Öl-Gemälde mit seichten Gitarren
Aber auch die restliche Optik ist durchaus schön anzusehen, sobald man sich daran gewöhnt hat. Die Welt sieht aus wie ein gezeichnetes Öl-Gemälde, das mehr Details bekommt, sobald man direkt davor steht. Alles, was sich hinter diesem Render-Radius befindet, sieht komplett verwaschen aus, gibt dem Spiel aber einen besonderen Art-Style und hat wahrscheinlich auch bei der technischen Umsetzung geholfen. Die Emotionen des Spiels werden aber am meisten durch den sehr schönen Soundtrack von Steven Wilson übertragen. Vor allem die seichten Gitarren und die stark akzentuierten Klänge, wenn der Soundtrack mehr in den Vordergrund gerückt wird, sind das, was die Musik ausmacht.
Sehr schwaches Gameplay
Doch am Ende muss man leider „Last Day of June” auch als ein Videospiel betrachten und da bleibt das Spiel dann doch stark hinter den Erwartungen zurück. In den Erinnerungen übernimmt man immer die Rolle einer der Figuren und muss sehr simple Rätsel lösen, die dazu führen, dass man das Schicksal ändert, damit June nicht stirbt. Leider gestalten sich die Rätsel aber wirklich so simpel, dass es in der Regel nur zwei oder einmal auch drei Lösungen gibt, die dann zu einem anderen Ende führen. Aber um da hinzukommen, macht man nichts anderes, als mehrere Minuten durch das idyllische Dorf zu laufen und dort die richtige Stelle zu finden, mit der man interagieren muss. Das Spiel wird dann auch noch einmal in die Länge gezogen, wenn man zwischen den Figuren wechseln muss und ein anderes Ende nimmt, um dann einen Gegenstand für die andere Figur zu haben, die dann dafür sorgt, dass es weiter geht. Auch wenn einige der Cutscenes dann abgekürzt werden, fehlt einem die Funktion, manuell Szenen zu überspringen. Zudem ist es einfach ein wenig langweilig, immer wieder zu wechseln, die gleichen Szenen zu sehen und dann wieder zu wechseln. Hier hätte ein etwas lineareres Gameplay vielleicht helfen können, den Spieler besser bei der Stange zu halten. Wie es jetzt ist, muss man sich doch durch die Mitte etwas quälen, um dann das doch lohnenswerte Finale genießen zu können.
















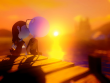

Das sagen unsere Leser:
Hab immer wieder von dem Spiel mitbekommen, weil Steven Wilson den Soundtrack macht.
Ich werd mal davon ausgehen, dass es The Last Day of June sicherlich irgendwann im PS+ geben wird.