Infinifactory (PSN)
Was passiert, wenn man aus „Minecraft“ ein Puzzle-Spiel macht? Das ist wohl der erste Gedanke, den die meisten beim Anblick von „Infinifactory“ haben dürften. Das Spiel erschien bereits vor einigen Monaten für den PC und wurde sowohl von Kritikern als auch Spielern gefeiert. Obwohl das Spiel sicherlich nicht der größte Erfolg war, folgte Ende 2015 eine Umsetzung für die PlayStation 4. Ist „Infinifactory“ nun ein gutes Spiel oder nur ein weiterer Titel, der einen Happen des „Minecraft“-Erfolges abhaben will? Das haben wir für euch herausgefunden, und zusätzlich ein wenig recherchiert.
Nur ein weiterer Klon?
Wie bereits geschrieben, wirkt das Spiel auf den Bildern wie ein „Minecraft“-Klon, obwohl das Spielprinzip durchaus anders ist. Wer aber einmal nachschaut, wer hier überhaupt am Werk ist, wird über den Namen Zachary Barth stolpern. Wer das ist? Niemand geringeres als der Macher von „Infiniminers“, dem Spiel, das Marcus Persson die Vorlage zum unvergleichlichen Erfolg „Minecraft“ bot. Dieser hat nämlich offen zugegeben, dass er nach dem Spielen von „Infiniminers“ zu dem Entschluss gekommen ist, an dem Block-Spiel zu arbeiten. Während dieser damit in die Geschichte einging, vergaßen viele schnell den Namen Zachary Barth, der jedoch nie damit aufhörte, Spiele zu entwickeln. Wenn man sich an diese Ausgangssituation erinnert, steht das Spiel plötzlich in einem ganz anderem Licht – und die Erwartungen steigen ebenso.
Die obligatorische Geschichte
Obwohl „Infinifactory“ einen erzählerischen Rahmen bietet, ist dieser alles andere als spannend. Als begabter Ingenieur wird der Held von mächtigen Aliens entführt und soll nun für diese verschiedene Aufgaben erledigen. Dazu gehören zum Beispiel der Bau von Raketen oder Terminals. Das alles macht sich sofort bezahlt, denn nach jedem erledigten Auftrag darf sich der Spieler über eine kleine Aufmerksamkeit und Nahrung freuen.
Das alles ist natürlich keine narrative Meisterleistung. Die Aliens sehen komisch aus, ihre Animationen sorgen für Gelächter und insgesamt interessiert es überhaupt nicht, was denn aus dem Hauptcharakter wird. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn schöner als eine simple Level-Auswahl ist das auf jeden Fall. Doch einige Audiologs von vorherigen Sklaven lassen sich dann doch finden, die für einige Lacher sorgen. Auch die Aufmerksamkeiten, die wir an dieser Stelle nicht verraten wollen, verdeutlichen den gelungenen, wenn auch speziellen Slapstick-Humor. Da das Spiel sowieso komplett auf das Gameplay ausgelegt ist, rückt die Rahmenhandlung aber eher in den weiten, weiten Hintergrund.
Leichter Einstieg, steile Lernkurve
Anfangs wirken die Aufgaben sehr einfach. Auf einer begrenzten Fläche müssen die Spieler kleine Fabrikanlagen bauen, um die Objekte herzustellen und zu transportieren. Dazu stehen einem verschiedene Block-Typen und Werkzeuge zur Verfügung, um die kleinen Anlagen zu erschaffen und lauffähig zu machen. Die ersten Level sind dazu gedacht, dem Spieler die Grundlagen beizubringen und sind dementsprechend einfach zu lösen.
Doch bereits nach kurzer Zeit macht das Spiel klar, dass es nicht nur für kurze Rätsel gut ist. Nach und nach werden die Aufgaben anspruchsvoller, immer mehr Blöcke werden verfügbar gemacht und ehe man sich versieht, baut man riesige Anlagen, bei denen das ungeübte Auge schnell den Überblick verlieren kann. Das Schönste dabei ist, dass der Kreativität der Spieler keine Grenzen gesetzt werden. Selbst wenn die Lösung kompakt sein sollte, kann jeder Spieler riesige Anlagen bauen und mehrere Lösungen ausprobieren. Das motiviert unglaublich, schreckt aber auch diejenigen ab, die sich nicht zu lange an einem Rätsel aufhalten wollen. Vor allem die Lernkurve wird im späteren Verlauf brutal, denn plötzlich werden die Herausforderungen viel schwieriger, was für Gelegenheitsspieler zum Albtraum werden dürfte.
Ein echter Zeitfresser
Besonders im späteren Verlauf wird klar, dass es sich hierbei nicht um einen Lückenfüller handelt. Einige Rätsel können durchaus über eine Stunde dauern, was am Trial-and-Error-Prinzip liegt. Selten ist der erste Gedanke richtig, und jeder Baustein wird in mehreren Testläufen überprüft. Sollte das Fließband wirklich von Punkt A nach B verlaufen, oder kann ich das nicht kompakter über Punkt C gestalten? Ist es nicht unsinnig, die Lieferung hier aufzuteilen? Und wieso ist der Übergang eigentlich immer fehlerhaft? Mit solchen Fragen dürfen sich die Spieler lange quälen, und es ist eine riesige Erlösung, wenn dann tatsächlich eine Stelle so läuft, wie sie es sollte – nur um eine Minute später zu sehen, dass ein anderes Teil wieder Probleme bereitet.
Doch selbst nach dem Abschluss einer Aufgabe ist noch nicht alles erledigt. Man kann nämlich immer irgendetwas optimieren, um eine leistungsfähigere Produktion zu erwirken. Das ist zwar nicht notwendig, um voran zu kommen, dennoch macht das unglaublich viel Spaß, vor allem, weil das Spiel anschließend immer eine kleine Statistik erstellt. Diese kann mit anderen Spielern online verglichen werden, so dass man immer das Gefühl hat, etwas besser machen zu müssen. Tatsächlich lernt der Spieler dabei auch einige neue Taktiken, mit denen zukünftige Aufgaben möglicherweise einfacher werden. Ebenso ist es immer wieder schön anzusehen, wie kompliziert man selber gedacht hat, obwohl die Lösung doch so einfach scheint. Natürlich muss man sich vor dem Kauf bewusst sein, dass diese Mechaniken maßgeblich zum Spielspaß beitragen. Wem das zu kompliziert, eintönig oder langweilig erscheint, der wird am Ende wahrscheinlich auch wenig Spaß während des recht langen Spieles haben.
Technik
Grafisch ist „Infinifactory“ alles andere als ein Meisterwerk. Zwar passt der sterile Stil sehr gut zur Atmosphäre, dennoch hat man sich gerade nach den längeren Rätseln erstmal satt gesehen. Da helfen auch die recht abwechslungsreichen Umgebungen und die sich farblich abhebenden Blöcke nicht wirklich. Allgemein hat man mittlerweile das Gefühl, dass die Blöcke-Optik die besten Jahre hinter sich hat. Da ist es auch egal, wer denn nun für diesen Trend verantwortlich ist. Glücklicherweise erleichtern die Formen aber auch die Übersicht, sodass es wenigstens sinnvoll ist, den Stil auch nach so vielen Jahre noch zu nutzen. Dafür bleibt die Bildrate stabil, selbst wenn viele Prozesse gleichzeitig ablaufen. Der Soundtrack ist eher unwichtig, wenn es überhaupt mal Hintergrundmusik gibt, und die Geräusche können nach einigen Aufgaben ebenfalls nervig werden, jedoch stören sie nie allzu sehr.
Die Steuerung ist ganz klar auf Tastatur und Maus ausgelegt. Mit diesem Hintergedanken ist die Controller-Steuerung allerdings keine Katastrophe. Der Spieler steuert den Hauptcharakter aus der Ego-Perspektive, während er die Objekte platziert. Wie schon in „Minecraft“ auf der PlayStation 4 geht das Bauen nicht allzu locker von der Hand und es benötigt einiges an Eingewöhnungszeit, um nicht immer und immer wieder die falschen Blöcke an die falschen Stellen zu packen. Glücklicherweise lässt einem die Einführung genug Zeit, um das zu üben. Vor allem längere Strecken lassen sich kinderleicht errichten, da das Spiel zum Beispiel Fließbänder bei gedrückten Knöpfen immer in einer geraden Linie aufbaut.










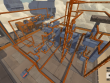
Das sagen unsere Leser: